Was den digitalen Euro von Kryptowährungen unterscheidet

Der digitale Euro: Eine neue Zahlungsoption der EZB
Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet seit Juli 2021 an der Einführung eines digitalen Euro (E-Euro oder D€). Dabei handelt es sich um eine digitale Form des Zentralbankgeldes, die als ergänzende Zahlungsmöglichkeit neben Bargeld eingeführt werden soll. Der digitale Euro wäre für Verbraucher kostenlos nutzbar und soll sowohl online als auch offline funktionieren. Er würde in einer elektronischen Geldbörse („Wallet“) verfügbar sein und über die bestehenden Geschäftsbanken verwaltet werden.
Wann kommt der digitale Euro?
Obwohl die Einführung des digitalen Euro als wahrscheinlich gilt, ist eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen. Nach einer zweijährigen Untersuchungsphase begann die EZB im November 2023 mit einer weiteren zweijährigen Vorbereitungsphase. Eine finale Entscheidung wird frühestens 2026 erwartet, mit einer potenziellen Einführung in den Jahren 2027 oder 2028. Vorher müssen noch rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen und regulatorische Fragen geklärt werden.
Unterschied zum bargeldlosen Bezahlen
Viele Zahlungen werden bereits digital über Bankkonten abgewickelt, etwa über Girokarten oder Online-Transaktionen. Doch der digitale Euro soll mehr Sicherheit bieten, da er direkt von der EZB herausgegeben würde. Während Girokonten und Zahlungsdienste wie PayPal oder ApplePay an Banken gebunden sind, bleibt der digitale Euro unabhängig von privaten Zahlungsanbietern.
Zudem betont die EZB, dass der digitale Euro mehr Privatsphäre gewährleisten soll: Während herkömmliche digitale Zahlungen oft persönliche Daten erfassen, soll der E-Euro ähnlich anonym wie Bargeld funktionieren.
Abgrenzung zu Kryptowährungen
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem digitalen Euro und Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum liegt in der Kontrolle durch eine Zentralbank. Der digitale Euro würde, wie klassisches Bargeld, direkt von der EZB ausgegeben und unterliegt deren geldpolitischer Steuerung. Im Gegensatz dazu sind Kryptowährungen dezentral organisiert und entziehen sich staatlicher Kontrolle.
Für Verbraucher ist vor allem wichtig, dass der digitale Euro ein gesetzliches Zahlungsmittel wäre. Das bedeutet, dass Geschäfte und Online-Händler ihn verpflichtend akzeptieren müssten. Kryptowährungen haben hingegen keinen Annahmezwang und werden oft nur eingeschränkt als Zahlungsmittel akzeptiert.
Warum drängen EU und EZB auf den digitalen Euro?
Neben Vorteilen für Verbraucher verfolgt die EU mit dem digitalen Euro strategische Ziele. Er soll die Souveränität des Euro im digitalen Zahlungsverkehr sichern, da immer mehr alternative Währungen auf den Markt drängen. Neben Kryptowährungen planen auch Staaten wie China oder die USA eigene digitale Währungen, die langfristig den Euro herausfordern könnten.
Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der europäischen Zahlungsinfrastruktur. Derzeit dominieren amerikanische Zahlungsanbieter wie Visa, Mastercard, GooglePay oder ApplePay den Markt. Mit dem digitalen Euro könnte ein unabhängiges europäisches Zahlungssystem etabliert werden. Laut EZB würde dies die „Widerstandsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im europäischen Zahlungsverkehr“ fördern.
Herausforderungen für Banken
Die private Kreditwirtschaft steht dem digitalen Euro zwiespältig gegenüber. Zwar wird eine europäische Digitalwährung grundsätzlich begrüßt, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf das Bankensystem.
Wenn Verbraucher große Summen in digitalem Euro halten, fehlen den Banken diese Gelder als Einlagen für Kredite. Deshalb wird ein Haltelimit von 3.000 Euro pro Nutzer diskutiert. Zudem könnte der digitale Euro in direkten Wettbewerb mit bestehenden Bankensystemen treten, wodurch sich die Geschäftsmodelle privater Banken verändern würden.
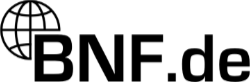
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.