Die Zukunft von Glyphosat: Was Deutschland jetzt erwartet

Die Zukunft von Glyphosat sorgt weiterhin für Spannungen in Politik, Landwirtschaft und Umweltschutz. Obwohl die Ampelregierung ursprünglich ein Verbot angekündigt hatte, bleibt der Einsatz des umstrittenen Herbizids in Deutschland vorerst möglich – zumindest bis zum Ablauf der EU-Zulassung im Jahr 2033.
Landwirte wie Stephan Obermaier setzen weiter auf Glyphosat. Seine Entscheidung ist praktisch motiviert: Zwischenfrüchte und Altverunkrautung auf dem Feld sollen effizient entfernt werden – und dafür greift er zum Totalherbizid. Der Wirkstoff ermöglicht eine bodenschonende Bearbeitung, etwa im Direktsaatverfahren, bei dem auf das Pflügen verzichtet wird.
Politische Uneinigkeit trotz Koalitionsvertrag
Im Koalitionsvertrag von 2021 stand es klar: „Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt.“ Doch als es im Jahr 2023 auf EU-Ebene zur Abstimmung über die Verlängerung der Zulassung kam, enthielt sich Deutschland – ausgerechnet wegen Uneinigkeit innerhalb der Ampel. Der Beschluss der EU-Kommission zur Verlängerung bis 2033 wurde ohne deutsche Gegenstimme gefasst.
Ein nationales Verbot wäre trotz EU-Zulassung denkbar, allerdings nur mit fundierter Begründung. Bisher fehlt ein solcher Schritt, und auch die neue Regierung aus Union und SPD bleibt in dieser Frage vage. Konkrete Aussagen zur Zukunft von Glyphosat sucht man im aktuellen Koalitionsvertrag vergeblich.
Rückzug vom Markt? Bayer zieht Konsequenzen
Ein weiterer Wendepunkt in der Debatte um die Zukunft von Glyphosat ist die Rolle des Herstellers Bayer. Der Konzern erwägt, das Glyphosat-Geschäft in den USA freiwillig einzustellen – ein Schritt, der in Deutschland jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen hätte. Der Grund: Seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 sieht sich Bayer mit zehntausenden Klagen konfrontiert, die das Krebsrisiko von Glyphosat thematisieren. Die Schadenssumme beläuft sich bereits auf über neun Milliarden Euro.
Trotzdem bleibt Glyphosat weltweit verfügbar, nicht zuletzt durch Hersteller aus China. Ein vollständiges Verbot in Deutschland würde also nicht das Ende des Wirkstoffs bedeuten, sondern eher eine Verschiebung der Bezugsquellen – und möglicherweise das Aufkommen neuer Produkte mit ähnlicher Wirkung, aber unbekannten Risiken.
Risiken und Alternativen im Fokus
Die Kritik an Glyphosat ist nicht neu. Umweltverbände wie der BUND sehen den Wirkstoff als Gefahr für die Artenvielfalt. Glyphosat wirkt nicht selektiv – es vernichtet nicht nur sogenanntes Unkraut, sondern alle grünen Pflanzen. In der Folge fehlen Nahrungspflanzen für Insekten und Lebensräume für Tiere. Diese ökologische Wirkung steht im Zentrum der Debatte über die Zukunft von Glyphosat.
Der BUND fordert daher ein Umdenken in der Landwirtschaft. Nicht-chemische Methoden wie mechanische Bodenbearbeitung, vielfältige Fruchtfolgen oder Mulchverfahren sollen Glyphosat langfristig ersetzen. Doch viele Landwirte, insbesondere im konservierenden Ackerbau, sehen das kritisch: Sie argumentieren mit Bodenschutz, Ressourcenschonung und Wirtschaftlichkeit.
Zwischen Regulierung und Praxis
Die Zukunft von Glyphosat wird nicht allein im Plenum entschieden, sondern auf den Feldern des Landes. Während Umweltverbände schärfere Regeln fordern, orientiert sich die Praxis an agrarwirtschaftlichen Realitäten. Für viele Betriebe ist Glyphosat ein bewährtes Instrument – nicht aus ideologischen Gründen, sondern aufgrund agronomischer Notwendigkeiten.
Der Blick nach vorne bleibt also ungewiss. Es braucht ein Zusammenspiel aus politischen Rahmenbedingungen, wissenschaftlicher Bewertung und praktischer Umsetzbarkeit. Dabei rückt die Frage in den Fokus, ob Verbote ohne tragfähige Alternativen tatsächlich zu einer nachhaltigen Agrarwende führen – oder lediglich neue Probleme schaffen.
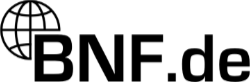
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.