Rabatte gegen Daten – Wie Discounter mit Kundendaten arbeiten

Im Supermarkt oder Discounter locken in fast jedem Gang Preisnachlässe: 30 % auf Tomaten, 20 % auf Joghurt oder 10 % auf Chips. Doch oft gilt der Rabatt nur für Kunden, die die hauseigene App installiert haben. Wer sie nicht nutzt, zahlt den vollen Preis. Das Modell „Rabatte gegen Daten“ ist im deutschen Einzelhandel längst gängige Praxis – und sorgt zunehmend für juristische Debatten.
Wie „Rabatte gegen Daten“ funktioniert
Apps von Discountern wie Lidl, Aldi, Rewe oder Edeka bieten personalisierte Coupons, Bonuspunkte und exklusive Angebote. Technisch betrachtet fungieren diese Apps als Schnittstelle zwischen Einkauf und Datenanalyse:
-
Erfassung persönlicher Daten: Bereits bei der Anmeldung werden Name, Alter, Geschlecht und bevorzugte Filiale erfasst.
-
Tracking von Kaufverhalten: Beim Einkauf – ob in der Filiale oder online – speichert die App, welche Produkte gekauft, zurückgegeben oder besonders oft gewählt werden.
-
Nutzung für Marketing: Diese Daten fließen in personalisierte Werbung, gezielte Rabattaktionen und sogar in Standortplanungen neuer Filialen ein.
Aus Sicht der Händler ist dies eine Win-win-Situation: Kunden erhalten günstigere Preise, das Unternehmen wertvolle Einblicke ins Konsumverhalten.
Juristische Auseinandersetzung um Rabatte gegen Daten
Der Fall Lidl zeigt, wie sensibel das Thema geworden ist. Die Verbraucherzentrale hat gegen den Discounter geklagt, weil Kunden beim Anmelden für die Bonus-App aus ihrer Sicht nicht ausreichend informiert werden. Streitpunkt ist vor allem die Intransparenz darüber, dass Rabatte mit persönlichen Daten „bezahlt“ werden.
Das Oberlandesgericht Stuttgart prüft nun, ob ein Unternehmen ein Angebot als „kostenlos“ bewerben darf, wenn die Gegenleistung in Form von Daten erfolgt. Das Verfahren könnte weitreichende Folgen haben: Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof ist bereits wahrscheinlich, und auch ein Gang vor den Europäischen Gerichtshof wird nicht ausgeschlossen.
Warum Händler auf „Rabatte gegen Daten“ setzen
Für Supermärkte und Discounter ist Datenanalyse ein zentrales Werkzeug, um die Kundenbindung zu stärken.
-
Gezielte Ansprache: Wer regelmäßig Milch oder Pasta kauft, bekommt häufiger Angebote dazu.
-
Effiziente Werbung: Statt teure Werbeprospekte flächendeckend zu verteilen, lassen sich gezielt nur die Kunden ansprechen, die wahrscheinlich reagieren.
-
Strategische Planung: Daten helfen bei der Entscheidung, wo neue Filialen eröffnet oder welche Produkte stärker beworben werden.
Einzelhandelsexperten sehen das Modell pragmatisch: Wer die App nicht nutzen möchte, kann weiterhin zum regulären Preis einkaufen. Für viele Kunden überwiegt jedoch der finanzielle Vorteil.
Datenschutz und Verbrauchersicht
Das Prinzip „Rabatte gegen Daten“ wirft wichtige Fragen auf:
-
Datensouveränität: Wissen Kunden wirklich, wie viele Informationen über ihr Einkaufsverhalten gesammelt werden?
-
Wert der Daten: Für Unternehmen sind diese Informationen bares Geld wert – für Kunden wird der „Preis“ meist nicht transparent ausgewiesen.
-
Rechtliche Grauzonen: Die EU-Richtlinien zum Verbraucherschutz lassen Spielraum bei der Bewertung, ob Daten eine geldwerte Gegenleistung darstellen.
Datenschützer fordern klare Kennzeichnungspflichten und einfache Opt-out-Optionen, damit Verbraucher selbst entscheiden können, wie weit sie ihre Einkaufsdaten preisgeben.
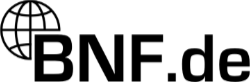
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.