Porsche stoppt Batterieproduktion in Deutschland – ein Symptom tieferliegender Probleme

Die Batterieproduktion in Deutschland sollte zum Kernstück der Transformation der Automobilindustrie werden. Doch der Rückzug von Porsche aus der Zellfertigung in Baden-Württemberg zeigt: Der Standort Deutschland kämpft mit strukturellen Herausforderungen, die nicht nur einen Autohersteller betreffen – sondern eine gesamte Industrie.
Standort Kirchentellinsfurt: Gescheiterte Hoffnung
Porsche hatte 2021 große Pläne mit der Gründung von Cellforce. Die Tochterfirma sollte eine hochspezialisierte Batterieproduktion in Deutschland aufbauen, mit Fokus auf Hochleistungszellen für sportliche Elektrofahrzeuge. Mehr als 50 Millionen Euro an staatlicher Förderung flossen in das Projekt – allein 14 Millionen aus Baden-Württemberg.
Doch nun ist Schluss. Rund 280 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. Die geplante „Anlauffabrik“ in Kirchentellinsfurt wird nicht wie geplant hochgefahren. Statt einer Skalierung des Pilotprojekts kommt das Aus. Begründet wird der Schritt mit einer global schwächelnden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen – insbesondere in China und den USA. Für Deutschland bedeutet das einen empfindlichen Rückschlag.
Fördergelder ohne Wirkung?
Die Entscheidung trifft nicht nur Beschäftigte, sondern auch Steuerzahler. Über 56 Millionen Euro an Fördermitteln stehen nun einem eingestellten Projekt gegenüber. Während das Bundeswirtschaftsministerium sich zu konkreten Konsequenzen bedeckt hält, wird deutlich: Die Politik steht vor der Frage, wie effektiv Industriepolitik in einem global umkämpften Sektor überhaupt noch sein kann.
Die Batterieproduktion in Deutschland war Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung industrieller Souveränität. Doch dieser Anspruch stößt in der Realität auf internationale Marktkräfte, die sich staatlich kaum kompensieren lassen.
Der globale Preiswettbewerb: Europa unter Druck
Ein zentrales Problem bleibt der Preis. Während China durch massive Subventionen eine Überproduktion an Batteriezellen generiert, kämpft Europa mit hohen Produktionskosten. Fachleute wie Helmut Ehrenberg vom KIT verweisen auf die Kombination aus hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel und geopolitischen Unsicherheiten. Die Batterieproduktion in Deutschland scheitert nicht an Know-how, sondern an strukturellen Wettbewerbsnachteilen.
Ehrenberg sieht besonders im Recycling Potenziale: Wenn Ressourcen wie Lithium und Kobalt vermehrt aus Altbatterien zurückgewonnen würden, könnte Europa unabhängiger agieren. Doch derzeit landen diese Rohstoffe über Umwege wieder in China – eine verpasste Chance.
Konkurrenz aus dem Ausland: USA und China setzen Standards
Neben China zieht auch die US-Industrie an Europa vorbei. Die amerikanische Handelspolitik macht es Unternehmen attraktiv, Standorte in den USA zu errichten. Subventionen, Steuererleichterungen und günstige Energiepreise setzen europäische Hersteller zusätzlich unter Druck.
Das Beispiel Northvolt in Schleswig-Holstein, dessen Projekt ebenfalls ins Wanken geraten ist, unterstreicht: Einzelinitiativen reichen nicht aus, wenn der gesamte Marktumfeld gegen eine heimische Produktion arbeitet.
Forschung statt Fertigung?
Porsche kündigt nun an, sich künftig auf Zell- und Systementwicklung zu konzentrieren. Forschung und Innovation sollen im Land bleiben – die industrielle Umsetzung aber nicht. Ob diese Strategie aufgeht, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Batterieproduktion in Deutschland braucht mehr als Fördergeld. Sie braucht stabile Rahmenbedingungen, strategische Ressourcenpolitik und einen realistischen Blick auf den globalen Wettbewerb.
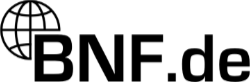
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.