Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI: Der stille Anstieg der Stromlast

Hitzewellen und Digitalisierung treiben Stromhunger
Der globale Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI hat 2024 ein neues Niveau erreicht. Laut dem aktuellen Energiebericht der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg der weltweite Energieverbrauch um 2,2 Prozent – deutlich schneller als im Zehnjahresdurchschnitt. Vor allem der Strombedarf legte mit 4,3 Prozent überdurchschnittlich zu. Der Grund: eine Kombination aus Rekordhitze und dem rasanten Wachstum digitaler Technologien, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz.
Klimaanlagen als Dauerläufer bei Hitze
Besonders stark ins Gewicht fiel der steigende Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI in Ländern wie China und Indien. Beide Länder litten 2024 unter extremen Temperaturen, was sich unmittelbar auf die Anzahl der betriebenen Klimaanlagen auswirkte. Der Stromverbrauch durch Kühlung stieg massiv an. Laut IEA lag der globale Wert der sogenannten „Abkühlgradtage“ um sechs Prozent über dem Vorjahr – und sogar 20 Prozent über dem Mittelwert der Jahre 2000 bis 2020. In einem immer heißeren Weltklima wird Kühlung mehr und mehr zum Grundbedürfnis.
Künstliche Intelligenz als verdeckter Stromtreiber
Neben der physischen Abkühlung wirkt auch die digitale Transformation als Beschleuniger des Energiehungers. Der Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI wird durch den rasanten Ausbau von Rechenzentren und stromintensiven KI-Anwendungen massiv verstärkt. Rechenzentren sind inzwischen für einen relevanten Teil des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Jeder neue KI-Dienst, jede Trainingsdatenbank und jedes Modelltraining erhöht die elektrische Last. Dieser Trend wird sich durch den weltweiten KI-Boom weiter verschärfen.
Erneuerbare Energien wachsen, reichen aber nicht
Positiv im Gesamtbild: Der Ausbau Erneuerbarer Energien erreichte 2024 einen neuen Höchstwert. Über ein Drittel des Energiezuwachses stammt aus nachhaltigen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Vor allem China übernahm mit riesigen Installationen von Photovoltaik-Anlagen die globale Führungsrolle. Aber auch in der EU und den USA wurden beachtliche Fortschritte gemacht. Dennoch reicht das Wachstum nicht aus, um den gesamten Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI zu decken – fossile Energieträger bleiben notwendig.
Renaissance der Kernenergie
Eine überraschende Entwicklung betrifft die Kernkraft. Weltweit wurden sechs neue Reaktoren in Betrieb genommen, zwei davon in China. Auch G7-Staaten wie die USA, Frankreich und Großbritannien investierten verstärkt in neue Kapazitäten. Der weltweite Zubau lag 2024 um ein Drittel höher als im Vorjahr. Für viele Länder gilt Atomkraft als emissionsarme Alternative, um den steigenden Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI ohne zusätzlichen CO₂-Ausstoß zu bewältigen.
Erdgas und Kohle bleiben im Spiel
Neben den Erneuerbaren legten auch fossile Energieträger erneut zu – wenn auch langsamer. Erdgas verzeichnete ein Nachfragehoch, da es vielerorts Öl zur Stromerzeugung ersetzt. Auch Flüssigerdgas (LNG) ist besonders in Europa weiterhin gefragt. Die Kohlenachfrage stieg um 1,1 Prozent – ein Miniwachstum, das vor allem auf die Hitzeperioden in Asien zurückzuführen ist. Die Stromproduktion aus Kohle wurde kurzfristig als Notlösung aktiviert, um den steigenden Kühlbedarf zu decken.
Ölnachfrage flacht erstmals ab
Erstmals zeigt sich auch ein Rückgang bei der Nachfrage nach Erdöl – insbesondere durch den wachsenden Markt für Elektroautos. In China, bisher einer der größten Ölverbraucher, sank der Verbrauch ölbasierten Kraftstoffe 2024. Ein deutliches Signal, dass sich Mobilität im Wandel befindet. Dennoch bleibt Öl global betrachtet weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Energiemix, wenn auch mit rückläufiger Tendenz.
Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI als Zukunftsfrage
Der Energiebedarf durch Klimaanlagen und KI entwickelt sich zu einer der zentralen Herausforderungen der globalen Energiepolitik. Während der technologische Fortschritt und der Kampf gegen den Klimawandel eigentlich Hand in Hand gehen sollen, offenbart sich in der Praxis ein Spannungsfeld: Die Technologien, die Emissionen verringern könnten, benötigen selbst enorme Energiemengen. Umso wichtiger wird es, diesen Bedarf konsequent mit emissionsarmen Quellen zu decken und neue Effizienzstandards für digitale Infrastrukturen zu etablieren.
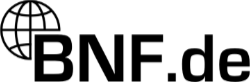
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.