Ladeinfrastruktur E-Auto: Ausbau überholt Nachfrage
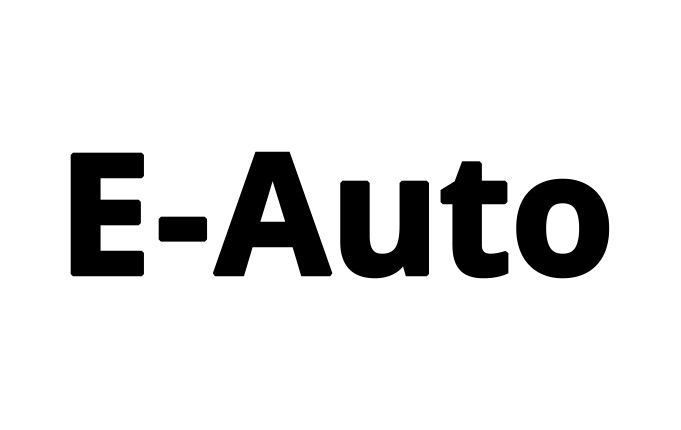
Die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Deutschland wächst schneller als der Markt. Ein Drittel der Säulen bleibt ungenutzt, während der Ausbau vielerorts weiterläuft. Was bedeutet das für die Zukunft der Elektromobilität?
Viele freie Ladepunkte: Infrastruktur läuft leer
Wer aktuell ein E-Auto fährt, findet in der Regel problemlos eine freie Ladesäule. Im zweiten Halbjahr 2024 waren laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nur etwa 17 Prozent der öffentlich zugänglichen Ladepunkte gleichzeitig belegt. Die durchschnittliche Auslastung zeigt: Der Ausbau der Ladeinfrastruktur E-Auto hat die tatsächliche Nutzung weit übertroffen.
Laut Analysen des Anbieters Elvah, der Echtzeitdaten auswertet, wird rund ein Viertel aller öffentlichen Ladepunkte gar nicht genutzt. In manchen Regionen beträgt die Auslastung nur drei Prozent – das bedeutet 97 Prozent freie Kapazitäten zu jeder Zeit.
Ausbau gedrosselt: Anbieter ziehen Konsequenzen
Der größte Betreiber, der Energieversorger EnBW aus Karlsruhe, hat bereits auf die geringe Auslastung reagiert. Das Ausbauziel wurde von 30.000 auf 20.000 Ladepunkte bis 2030 reduziert. Laut Vorstand Dirk Güsewell gebe es derzeit keinen Engpass bei der Ladeinfrastruktur E-Auto.
Dennoch wird der Ausbau nicht vollständig gestoppt. Die Anpassung basiert auf einer Verschiebung des erwarteten Bedarfs. Standorte werden laut EnBW nach einer prognostizierten Auslastung in fünf Jahren geplant. Viele Säulen seien also schlicht „noch nicht“ genutzt – der Bedarf werde mit steigender Zahl an E-Fahrzeugen steigen.
Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage
Der Bestand an Ladepunkten wächst rapide: Anfang 2025 waren in Deutschland 161.686 Ladepunkte registriert, davon 36.278 Schnelllader. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 21 Prozent – bei den Schnellladepunkten sogar 39 Prozent. Die Bundesregierung strebt weiterhin eine Million Ladepunkte bis 2030 an.
Dem steht eine langsam wachsende E-Auto-Flotte gegenüber. Laut BDEW liegt der Fokus daher weniger auf dem Ausbau der Ladeinfrastruktur E-Auto, sondern auf der Nachfrageförderung für E-Fahrzeuge. Günstigere Modelle, verlässliche CO₂-Regulierungen und gezielte Kaufanreize seien laut Branchenvertretern notwendig.
Regionale Unterschiede bei der Nutzung
Ein weiterer Aspekt: Die Auslastung variiert stark zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Je nach Region liegt sie zwischen drei und 40 Prozent. Einflussfaktoren sind die E-Auto-Dichte, Ladeleistung der Säulen sowie private Lademöglichkeiten. In Städten mit vielen Laternenparkern steigt die Nachfrage nach öffentlichen Ladepunkten, während in ländlichen Gebieten oft zu Hause geladen wird.
Langfristige Perspektive für die Ladeinfrastruktur
Trotz der derzeitigen Überkapazitäten bleibt die flächendeckende Verfügbarkeit wichtig für das Vertrauen in die Elektromobilität. Anbieter wie EnBW orientieren sich deshalb an langfristigen Bedarfsprognosen. Denn die Ladeinfrastruktur E-Auto muss nicht nur heutige, sondern auch künftige Anforderungen abdecken – auch wenn viele Ladepunkte heute noch leer bleiben.
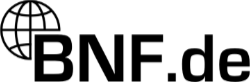
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.