Kosten für den digitalen Euro: Milliardenkosten für Banken im Euroraum?

Die Einführung des digitalen Euro bringt nicht nur technologische Innovation, sondern auch erhebliche Kosten für die europäische Bankenlandschaft mit sich. Insbesondere die Kosten für den digitalen Euro werfen Fragen auf – sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus struktureller Perspektive.
Digitale Umrüstung mit Milliardenaufwand
Eine aktuelle Analyse von PwC beziffert die Implementierungskosten des digitalen Euro für 19 europäische Banken bereits auf über zwei Milliarden Euro. Hochgerechnet auf den gesamten Euroraum könnten die Kosten für den digitalen Euro je nach Ausgestaltung zwischen 18 und 30 Milliarden Euro liegen.
Die größten Kostentreiber:
-
Anpassung von Geldautomaten-Infrastruktur
-
Umstellung digitaler Bankkanäle wie Mobile- und Online-Banking
-
Integration neuer Bezahlfunktionen in physische Karten und Terminals
Besonders drastisch fällt der Aufwand bei der Umrüstung der Geldautomaten-Infrastruktur aus – durchschnittlich neun Millionen Euro pro Bank. Damit geraten viele Institute bereits vor dem offiziellen Start des digitalen Euro unter erheblichen Investitionsdruck.
Digitalisierung auf Kosten der Innovation?
Neben finanziellen Belastungen beleuchtet die Studie auch die Auswirkungen auf das Personal. Rund die Hälfte der qualifizierten IT- und Zahlungsverkehrsspezialisten könnte über Jahre in das Projekt gebunden werden. In einer Branche, die stark auf Innovationszyklen angewiesen ist, birgt das Risiken für andere zukunftsorientierte Projekte.
Kosten für den digitalen Euro: Banken zweifeln am Nutzen
Die Haltung der Banken bleibt verhalten. In Deutschland äußern Sparkassen und Geschäftsbanken erhebliche Zweifel am Mehrwert des digitalen Euro gegenüber etablierten Lösungen wie Echtzeitüberweisungen. Zusätzliche Systemkomplexität und regulatorische Unklarheiten erschweren die Planung.
Darüber hinaus bestehen Sorgen, dass der digitale Euro in Krisenzeiten zur Kapitalflucht führen könnte – weg von Geschäftsbanken, hin zu digitalem Zentralbankgeld. Solche Szenarien lassen Überlegungen zu Halteobergrenzen realistischer erscheinen, um die Stabilität des Bankensektors zu wahren.
Digitale Souveränität als strategisches Ziel
Trotz der Kosten für den digitalen Euro verfolgt die Europäische Zentralbank klare Ziele: Die strategische Unabhängigkeit Europas im Zahlungsverkehr soll gestärkt, die Dominanz US-amerikanischer Zahlungsdienste verringert werden. Der digitale Euro soll ein universeller, sicherer und europaweit nutzbarer Zahlungsweg sein – mit höherem Datenschutz als marktübliche Dienste bieten.
Wie geht es weiter?
Die aktuelle Vorbereitungsphase läuft bis Ende 2025. In dieser Zeit werden technische Tests durchgeführt, Designentscheidungen getroffen und Pilotprojekte vorbereitet. Eine Einführung ab 2026 ist möglich – aber nur, wenn Handel, Verbraucher und Banken den digitalen Euro auch wirklich akzeptieren. Der Fokus liegt auf Ergänzung, nicht Verdrängung von Bargeld.
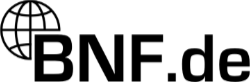
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.