Chinas Kohlepolitik bleibt widersprüchlich trotz Ausbau der Erneuerbaren
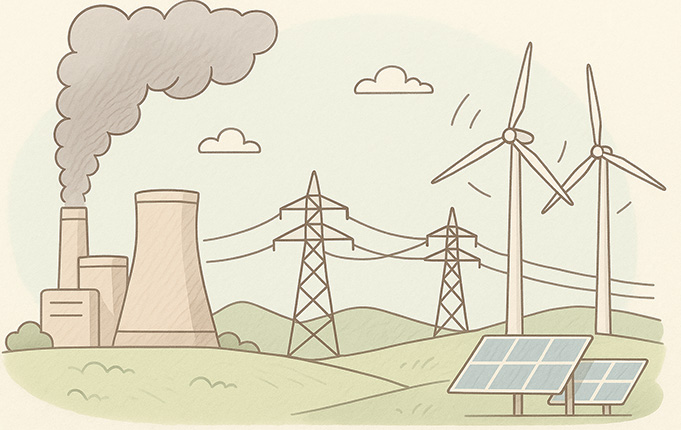
Trotz massiver Investitionen in grüne Energie setzt Chinas Kohlepolitik weiterhin stark auf fossile Energieträger. Im ersten Halbjahr 2025 nahm die Volksrepublik so viel neue Kohlekraftwerke ans Netz wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Das Wachstum bei Wind- und Solarkraft beeindruckt – doch der parallele Ausbau der Kohle-Infrastruktur wirft Fragen zur langfristigen Ausrichtung auf.
Kohleausbau in historischem Umfang
Mit 21 Gigawatt an neuer Kohlekraft innerhalb von nur sechs Monaten erreicht Chinas Kohlepolitik einen neuen Höhepunkt seit 2016. Analysten erwarten bis Jahresende über 80 Gigawatt zusätzlicher Kapazität. Damit wird deutlich: Trotz internationaler Verpflichtungen bleibt Kohle ein fester Bestandteil der chinesischen Energieversorgung – und das voraussichtlich noch für viele Jahre.
Die Gründe für diesen Kurs liegen in der Absicherung der Energieversorgung. Kohle gilt weiterhin als Rückgrat in Zeiten schwankender Verfügbarkeit von Wind- und Solarstrom. Statt flexibler Nutzung setzt China jedoch auf dauerhaften Betrieb neuer Anlagen – eine Strategie, die das Energiesystem stabilisiert, aber Investitionen bindet, die andernorts effektiver eingesetzt wären.
Paralleler Schub bei Erneuerbaren
Gleichzeitig schreitet der Ausbau von Wind- und Solarenergie mit enormem Tempo voran. 500 Gigawatt an grüner Energie sollen 2025 neu hinzukommen – eine Dimension, von der Europa weit entfernt ist. Zum Vergleich: Deutschland brachte es im Vorjahr auf lediglich rund 20 Gigawatt.
Diese parallelen Entwicklungen zeigen, dass Chinas Kohlepolitik nicht als reiner Rückschritt zu werten ist. Vielmehr betreibt das Land eine Zwei-Gleis-Strategie: Ausbau der Erneuerbaren bei gleichzeitiger Stabilisierung durch fossile Quellen. Der CO₂-Ausstoß aus dem Energiesektor sank dennoch um drei Prozent im Halbjahresvergleich – ein Teilerfolg inmitten widersprüchlicher Entwicklungen.
Neue Projekte trotz Klimazielen
Brisant ist vor allem der Ausblick: China genehmigte allein im ersten Halbjahr 2025 weitere Kohlekraftprojekte mit 25 Gigawatt. Zusätzlich wurden zahlreiche bereits geplante oder pausierte Projekte mit zusammen 75 Gigawatt reaktiviert. Viele Betreiber scheinen bewusst auf das Zeitfenster bis 2030 zu setzen – jenes Jahr, in dem China den Höhepunkt seiner CO₂-Emissionen erreichen will.
Doch bisher fehlt eine konsistente Strategie zum Kohleausstieg. Laut Analysten liegt die Stilllegung alter Anlagen deutlich hinter den offiziellen Zielen. Die neue Welle von Genehmigungen verschärft diesen Trend. Offen bleibt zudem, welche konkreten Energieziele Peking im nächsten Fünfjahresplan formulieren wird.
Internationale Erwartungen vs. nationale Realität
Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt trägt China eine zentrale Verantwortung im globalen Klimaschutz. Die Kohlebeschlüsse der Weltklimakonferenz in Glasgow werden zwar nicht ignoriert – aber auch nicht konsequent umgesetzt. Solange Chinas Kohlepolitik weiterhin auf neuen Kapazitätsaufbau setzt, bleibt die Glaubwürdigkeit der Klimaversprechen eingeschränkt.
Die strukturelle Abhängigkeit von Kohle bei gleichzeitigem Rekordausbau Erneuerbarer verdeutlicht: Der Umbau des chinesischen Energiesektors ist ein langfristiger, widersprüchlicher Prozess. Fortschritte und Rückschritte stehen sich gegenüber – mit globalen Auswirkungen.
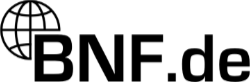
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.