Stablecoins erklärt: Warum digitale Währungen an Bedeutung gewinnen

Digitale Zahlungsmittel erleben einen Wandel. Besonders Stablecoins rücken immer stärker in den Fokus von Investoren, Regulierern und Regierungen. Doch was steckt hinter dieser Technologie – und welche Risiken bringt sie mit sich?
Stablecoins erklärt: Die digitale Währung mit fester Bindung
Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert in der Regel fest an traditionelle Währungen wie den US-Dollar oder den Euro gekoppelt ist. Ziel dieser Konstruktion ist es, Stabilität in ein ansonsten hochvolatiles Umfeld zu bringen. Im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum schwankt der Kurs eines Stablecoins nur geringfügig – theoretisch. Das Prinzip: Für jeden ausgegebenen Coin wird ein entsprechender Betrag in einem sicheren Reservefonds hinterlegt.
Warum Stablecoins für Investoren interessant sind
Wer Stablecoins erklärt, stößt schnell auf ihre Funktion als Brücke zwischen Fiat-Währung und Blockchain. Sie bieten schnellen Zugang zu digitalen Märkten, ohne dass Anleger in riskante Coins investieren müssen. Viele nutzen sie, um kurzfristig Kapital zu parken oder um Arbitrage-Möglichkeiten zwischen verschiedenen Handelsplätzen auszunutzen. Insbesondere in Regionen mit instabilen nationalen Währungen erfreuen sich Stablecoins wachsender Beliebtheit.
Die Marktmacht von Tether und USD Coin
Aktuell dominieren zwei Anbieter den Markt: Tether (USDT) und USD Coin (USDC). Gemeinsam kontrollieren sie rund 90 Prozent der weltweiten Stablecoin-Marktkapitalisierung. Diese Marktkonzentration birgt Chancen – aber auch Risiken, sollte einer der Anbieter in Schwierigkeiten geraten.
Stablecoins erklärt: Wie sicher sind die Reserven?
Ein zentrales Versprechen von Stablecoins ist ihre vollständige Absicherung durch liquide Vermögenswerte. In den USA sind dies meist kurzfristige Staatsanleihen, die als besonders sicher gelten. Kritiker bemängeln jedoch mangelnde Transparenz: Nicht alle Anbieter legen ihre Reserven offen oder lassen sich regelmäßig extern prüfen. Gerade im Fall von Tether gab es wiederholt Zweifel an der tatsächlichen Hinterlegung der ausgegebenen Coins.
USA setzen mit Genius Act auf neue Standards
Der sogenannte Genius Act aus den USA bringt erstmals einheitliche Regeln für Stablecoins. Er schreibt vor, dass digitale Dollar durch sichere, liquide Assets gedeckt sein müssen. Ziel ist es, den Finanzplatz USA zu stärken, Investoren zu schützen und den US-Dollar als Leitwährung im digitalen Raum zu etablieren. Zugleich zeigt sich: Auch bei Stablecoins, kommt man nicht an geopolitischen Interessen vorbei.
Europa verliert regulatorisch den Anschluss
Während die USA klare Rahmenbedingungen schaffen, gilt die EU-Regulierung (MiCA) als zu komplex. Sie verlangt etwa, dass signifikante Stablecoins einen Großteil ihrer Reserven in Bankeinlagen halten. Das birgt Risiken – insbesondere, wenn Banken in Schieflage geraten. Fachleute kritisieren, dass zentrale Aspekte wie Zentralbankguthaben als sichere Reserveform nicht ausreichend berücksichtigt wurden. So werden Stablecoins in Europa oft durch politische Interessen überlagert.
Einsatz weltweit: Vom Wertspeicher bis zur Zahlungslösung
In Ländern wie Brasilien, Nigeria oder der Türkei spielen sie längst eine größere Rolle. In Teilen Lateinamerikas machen sie bis zu 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Sie dienen dort nicht nur als Wertspeicher, sondern auch als Mittel für grenzüberschreitende Zahlungen. Ihre Rolle als Finanzinstrument wächst – gerade in Regionen, in denen Banken kaum zugänglich oder wenig vertrauenswürdig sind.
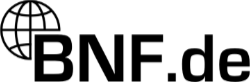
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.