Der Windkraftausbau Europa stockt – nur Deutschland liefert
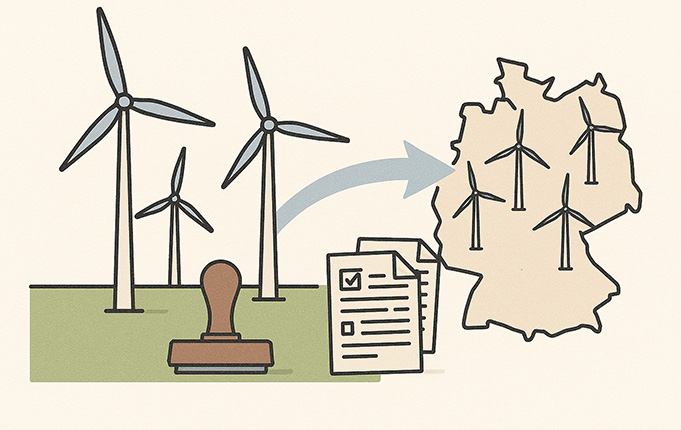
Der Windkraftausbau in Europa bleibt im Jahr 2025 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Während Deutschland beim Zubau neuer Anlagen führt, bremsen unklare Genehmigungsprozesse und strukturelle Engpässe in vielen anderen EU-Staaten den Fortschritt. Der europäische Branchenverband WindEurope warnt vor massiven Folgen für Klimaziele und Wettbewerbsfähigkeit.
Prognosen deutlich nach unten korrigiert
Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Europa lediglich 6,8 Gigawatt an neuer Windkraftleistung installiert, davon 5,3 Gigawatt innerhalb der 27 EU-Mitgliedstaaten. Damit liegt der tatsächliche Ausbau weit unter den ursprünglichen Prognosen. WindEurope sah ursprünglich 22,5 Gigawatt an Neuleistung für ganz Europa voraus, senkte diese nun jedoch auf nur noch 19 Gigawatt. Für die EU selbst wurde die Prognose von 17 auf 14,5 Gigawatt gesenkt.
Diese Entwicklung gefährdet nicht nur die angestrebten Klimaziele der Europäischen Union, sondern stellt auch ein Risiko für die Energiesicherheit dar. Der Windkraftausbau Europa kommt nicht nur zu langsam voran – er verfehlt zentrale Vorgaben der Energiepolitik.
Deutschland als Lichtblick
Im europäischen Vergleich zeigt sich Deutschland als einzige Konstante. Mit einem Zubau von rund 2,2 Gigawatt liegt die Bundesrepublik klar vor allen anderen EU-Staaten. Damit entfallen etwa 42 Prozent der neuen Windkraftleistung in der EU auf Deutschland – sowohl an Land als auch auf See.
Entscheidend dafür ist die konsequente Umsetzung neuer Genehmigungsregeln, die von der EU eingeführt wurden. Deutschland hat frühzeitig reagiert und ermöglicht damit eine deutliche Beschleunigung von Planungs- und Bauprozessen. Im Jahr 2025 entstehen fünf große Onshore-Projekte, nahezu dreimal so viele wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre.
Schwache Genehmigungspraxis in vielen EU-Staaten
In den übrigen 26 EU-Ländern zeigt sich ein konträres Bild: Die Genehmigung neuer Windparks dauert häufig länger als die EU-weit festgelegten 24 Monate. Laut WindEurope halten sich keine weiteren Mitgliedstaaten an diese Vorgabe. Im Gegenteil: In vielen Ländern verschlechtert sich die Genehmigungspraxis weiter.
Zusätzlich erschweren neue Regelungen wie sogenannte Förderzonen für erneuerbare Energien den Ausbau, statt ihn zu erleichtern. Unklare Zuständigkeiten, langsame Verwaltungsprozesse und widersprüchliche Vorschriften sorgen für Planungsunsicherheit bei Investoren und Projektentwicklern. Der Windkraftausbau Europa leidet damit unter einem strukturellen Umsetzungsdefizit.
Infrastrukturprobleme bremsen Offshore-Projekte
Besonders im Bereich Offshore-Windkraft gibt es zusätzliche Herausforderungen. Der Bau neuer Anlagen wird durch Engpässe in den Stromnetzen sowie unzureichende Hafen- und Schiffskapazitäten behindert. Die notwendige Logistik für Installation, Wartung und Netzanschluss hinkt der technologischen Entwicklung hinterher.
Auch bei der Elektrifizierung weiter Teile der Industrie fehlt vielerorts das notwendige Tempo. Ohne moderne Stromnetze und leistungsfähige Infrastruktur drohen Verzögerungen, die sich langfristig auf das gesamte Energiesystem auswirken.
Windkraftausbau bleibt Schlüssel zur Energiewende
Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sieht WindEurope langfristig Potenzial. Bis zum Jahr 2030 soll die EU eine installierte Windkraftkapazität von 344 Gigawatt erreichen. Um die Klimaziele zu erfüllen, müsste diese Zahl sogar auf 425 Gigawatt steigen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch soll dann bei mindestens 42,5 Prozent liegen.
Damit der Windkraftausbau Europa dieses Ziel erreichen kann, sind jedoch tiefgreifende Maßnahmen erforderlich: Neben der vollständigen Umsetzung einheitlicher Genehmigungsregelungen fordern Branchenvertreter Investitionen in Netzstabilität, Hafeninfrastruktur und industrielle Elektrifizierung.
Politischer Handlungsdruck wächst
Der schleppende Fortschritt erhöht den politischen Druck auf die EU-Staaten. Ohne koordinierte Maßnahmen droht ein Rückfall hinter internationale Wettbewerber wie China oder die USA, die ihre Windkraftkapazitäten deutlich schneller ausbauen. Die europäische Industrie ist auf günstige und stabile Strompreise angewiesen, um im globalen Vergleich bestehen zu können.
Insbesondere die Verzögerungen beim Windkraftausbau Europa könnten sich somit zu einem Standortnachteil entwickeln. Der Energiepreis wird zunehmend zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor in der europäischen Wirtschaftspolitik.
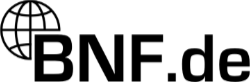
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.